Die Zukunft Europas angesichts der Kultur des Todes
[shariff]
Dienstag 21. Januar 2020 von Prof. Dr. Manfred Spieker
„Der erfreulich großen Sensibilität des heutigen Menschen für die ihn umgebende außermenschliche Schöpfung steht eine erschreckende Blindheit für den zerstörerischen Umgang des Menschen mit sich selbst und der ihm eigenen Geschöpflichkeit gegenüber“, so die Salzburger Erklärung, die beim VI. Ökumenischen Bekenntnis-Kongress der IKBG 2015 verabschiedet wurde (Z.2). Schon vier Jahre zuvor hatte Papst Benedikt XVI. in seiner Rede im Deutschen Bundestag ebenfalls die Sensibilität der ökologischen Bewegung in der deutschen Politik gelobt, aber zugleich ihre Blindheit gegenüber der Ökologie des Menschen getadelt. Anlass für diesen Tadel war die Genderideologie, die die Heterosexualität für eine Konstruktion der Gesellschaft und der Kultur hält und die geschlechtliche Identität der freien Selbstbestimmung des Menschen unterwirft, die also dem biblischen Verständnis von Geschöpflichkeit und Liebe widerspricht und letztlich auf eine leibfeindliche Gnosis hinausläuft. Die Genderideologie ist ein Aspekt der Kultur des Todes. Sie unterwirft nicht nur Ehe und Familie sondern das Leben selbst dem Willen des Menschen. Pro Choice ist ihr Standpunkt, nicht Pro Life.
In den vier Jahren seit dem VI. Kongress ist die Lage weder in Deutschland noch in Europa besser geworden. Im Gegenteil, die Genderideologie und die Kultur des Todes haben zentrale Bereiche der Rechtsordnung, der Gesellschaft und selbst der Kirchen verändert. Am 30. Juni 2017 hat sich der Bundestag vom Verständnis der Ehe als einem auf Dauer und die Geburt von Kindern angelegten Bund von Mann und Frau verabschiedet und die Ehe für alle legalisiert. In den Kirchen, selbst in der katholischen, wird über die Segnung homosexueller Partnerschaften diskutiert und in manchen evangelischen Landeskirchen wird sie auch schon praktiziert. Rund die Hälfte der Länder der EU hat die Ehe für alle ebenfalls legalisiert und die Länder, die sich dagegen wappnen wollen, indem sie in ihren Verfassungen die Ehe als Bund von Mann und Frau und die Familie als Gemeinschaft verschiedenen Geschlechter und Generationen definieren, sehen sich der Kritik von Brüssel ausgesetzt. Die Suizidassistenz wurde zwar für Vereine, die sie geschäftsmäßig betreiben, verboten, aber für Angehörige des Suizidenten und ihm nahestehende Personen, einschließlich der Ärzte, ausdrücklich erlaubt. Die auf der Genderideologie beruhende Sexualpädagogik der Vielfalt hat die Curricula zahlreicher Bundesländer erobert, darunter auch solcher, die von Christdemokraten regiert werden. Das Embryonenschutzgesetz von 1990, das dem Schutz des Embryos in der assistierten Reproduktion und nicht der Reproduktionsfreiheit Erwachsener dient, ist zahlreichen Attacken von Reproduktionsmedizinern und verschiedenen Parteien ausgesetzt, die es durch ein Reproduktionsmedizingesetz ersetzen wollen, um nach der Ehe für alle auch Kinder für alle zu ermöglichen. In Frankreich diskutiert die Nationalversammlung gerade ein Gesetz zur assistierten Reproduktion (PMA=Procréation medicalement assistée sans père), durch das nicht nur die künstliche Befruchtung für alle, sondern auch Eizellspende, Leihmutterschaft, die Herstellung von Chimären und die Forschung an Embryonen bis zum 14. Tag legalisiert werden sollen. In anderen Ländern der EU wie Spanien, Tschechien, Dänemark, Belgien und Großbritannien sind Eizellspenden bereits erlaubt. Dies sind nur wenige Hinweise auf Entwicklungen seit 2015. Sie machen es nicht leicht, über die Zukunft Europas zu reden, zumal Professoren keine Propheten sind. Sie verstehen sich in der Regel eher auf Analysen als auf Prophetien. Was ist die Kultur des Todes, wie soll Europa ihr entgehen? Unter welchen Bedingungen lässt sich der Kultur des Todes eine Kultur des Lebens gegenüberstellen und festigen?
I. Die Kultur des Todes
Die Kultur des Todes ist ein sperriger Begriff. Sie hat nichts zu tun mit der ars moriendi, jener Kunst des Sterbens eines reifen Menschen, der dem Tod ebenso bewusst wie gelassen entgegengeht, ja ihn, wie Franz von Assisi, als Bruder begrüßt. Sie hat auch nichts zu tun mit Mord und Totschlag, die es unter Menschen gibt, seit Kain Abel erschlug, auf denen aber immer der Fluch des Verbrechens lag. Als Kultur des Todes werden vielmehr ein Verhalten einerseits und gesellschaftliche sowie rechtliche Strukturen andererseits bezeichnet, die bestrebt sind, das Töten gesellschaftsfähig zu machen, indem es als medizinische Dienstleistung oder als Sozialhilfe getarnt wird. Die Kultur des Todes will das Töten vom Fluch des Verbrechens befreien. Sie hat sich seit 1974 in Deutschland und in vielen Ländern Europas ausgebreitet – am Anfang des Lebens im Abtreibungsstrafrecht, das sich in der öffentlichen Wahrnehmung immer mehr in ein Abtreibungsrecht verwandelt hat, in der Legalisierung der embryonalen Stammzellforschung und der Präimplantationsdiagnostik, in der assistierten Reproduktion selbst, die das Tor zur Genchirurgie geöffnet hat, und in der Suizidbeihilfe in § 217 StGB. Die Kultur des Todes bedient sich verschiedener Tarnkappen.
Unter der Tarnkappe einer Verbesserung des Lebensschutzes und einer Eindämmung der Zahl der Abtreibungen legalisierte der Gesetzgeber die Tötung ungeborener Kinder in den ersten drei Monaten einer Schwangerschaft. In seiner letzten Reform 1995, die dem § 218 seine heute geltende Fassung gibt, bekräftigte der Bundestag den Paradigmenwechsel vom Lebensschutz durch ein strafbewehrtes Abtreibungsverbot, das wenigstens noch auf dem Papier stand, zum Lebensschutz durch eine Beratungspflicht, mit der er behauptete, das ungeborene Kind besser schützen zu können. Der Staat wurde verpflichtet, ein flächendeckendes Netz nicht nur von Beratungs‑, sondern auch von Abtreibungseinrichtungen vorzuhalten und eigene Sozialhilferegelungen zwecks Übernahme der Abtreibungskosten zu treffen. Das Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz von 1995 lässt „den Staat zum Komplizen der Tötung verkommen“ (Herbert Tröndle). „Der Staat tötet“, so hat Josef Isensee die Reform auf den Punkt gebracht.
Eine zweite Tarnkappe der Kultur des Todes ist die Abtreibungsstatistik. Sie suggeriert seit Jahren fallende Abtreibungszahlen, die den Eindruck vermitteln sollen, die Reform des § 218 habe sich bewährt. 2,2 % weniger Abtreibungen im 2. Quartal 2019 meldete das Statistische Bundesamt am 12.9.2019. In den 45 Jahren seit der Freigabe der Abtreibung 1974 in Westdeutschland und 1972 in der DDR sind nach der Statistik des Statistischen Bundesamtes in Ost- und Westdeutschland bis zum 30. Juni 2019 6.127.291 Kinder getötet worden, nach plausiblen Schätzungen aber mehr als zwölf Millionen. Der Bundestag wurde durch das Bundesverfassungsgericht 1993 zu einer Erfolgskontrolle seines Paradigmenwechsels verpflichtet. Wäre er an dieser Erfolgskontrolle wirklich interessiert, müsste er dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts nachkommen, das Gesetz zu korrigieren und nachzubessern, wenn sich herausstellt, dass das vom Grundgesetz geforderte Maß an Schutz des ungeborenen Lebens nicht gewährleistet ist (BVerfGE 88, 203, 309). Zuverlässigere Zahlen könnten die Tarnkappe, der Paradigmenwechsel vom Lebensschutz durch ein strafbewehrtes Abtreibungsverbot zum Lebensschutz durch eine Beratungspflicht diene dem Lebensschutz, zerreißen.
Die dritte und bei weitem wirkungsvollste Tarnkappe der Kultur des Todes ist der Schein der Schwangerschaftskonfliktberatung, der eine Beratung zum Schutz des Kindes dokumentieren soll. Eine Frau, die sich in einem Konflikt mit ihrer Schwangerschaft befindet und erwägt, das Kind abzutreiben, muss sich diesen Schein in einer anerkannten Beratungsstelle ausstellen lassen und dem Abtreibungsarzt vorlegen. Der Schein ist, daran führt kein Weg vorbei, eine Tötungslizenz, derer weniger die Frau als vielmehr der Arzt bedarf, um gesetzeskonform zu handeln. Die Tötungslizenz tarnt sich als Nachweis einer Beratung, die nach § 219 StGB dem Schutz des ungeborenen Lebens dienen und der Frau bewusst machen soll, „dass das Ungeborene in jedem Stadium der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat“, die gleichzeitig nach § 5 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes aber „nicht belehren und bevormunden“ soll. Die Reform des § 218 macht somit, schrieb Papst Johannes Paul II. 1999 den deutschen Bischöfen, „den Lebensschutz durch Beratung über den Nachweis der Beratung zugleich zum Mittel der Verfügung über menschliches Leben“. Sie verknotet „in unentwirrbarer Weise Ja und Nein“ zum ungeborenen Leben. Deshalb könne die Kirche an diesem Gesetz nicht mitwirken. Vom eigenen Lebensrecht des ungeborenen Kindes bleibt in der mit dialektischer Raffinesse konzipierten Beratungsregelung nichts mehr übrig. Der Vorgang, der dem Schutz seines Lebens dienen soll, ist eo ipso die Bedingung seiner nicht nur straflosen, sondern staatlich geförderten Tötung.
Eine vierte Tarnkappe ist der seit August 2012 in der Pränataldiagnostik angebotene Praenatest. Er verspricht ein Mutter und Kind schonendes nichtinvasives Verfahren zur pränatalen Diagnostik. Mittels eines Bluttests soll festgestellt werden, ob der Embryo bestimmte Dispositionen für Erkrankungen hat. Der Test vermeide die für den Embryo in 0,5 bis ein Prozent der Fälle tödlichen Risiken der invasiven Amniozentese (Fruchtwasseruntersuchung) und der ebenfalls invasiven Chorionzottenbiopsie (Gewebeuntersuchung). Der Gemeinsame Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen hat im September entscheiden, dass dieser Bluttest in den Leistungskatalog der Krankenkassen aufgenommen werden soll. Er diene der Beruhigung der Schwangeren und werde auch, wie seine medizinischen Anwälte (Holzgreve, Diedrich) betonen, immer präziser. Dies ist jedoch nicht einmal die halbe Wahrheit. Der Praenatest dient in erster Linie der Fahndung nach Embryonen mit Trisomie 21, inzwischen aber auch mit anderen Auffälligkeiten. Für Embryonen mit solchen Auffälligkeiten ist er ein Todesurteil. Deshalb werden Kinder mit Trisomie 21 auch kaum noch geboren. Der Praenatest macht den Lebensschutz vom Bestehen einer Prüfung abhängig. Er steht darüber hinaus im Dienst ökonomischer Kalkulationen. Ein flächendeckender Test ist für die Krankenkassen billiger als die Versorgung von Kindern mit Trisomie 21. Eltern, die ein Kind mit Trisomie 21 nicht abtreiben, werden sich eines Tages rechtfertigen müssen, weshalb sie ihre Mitbürger mit erhöhten Kosten für ein „vermeidbares“ Schicksal belasten.
Das Recht auf „sexuelle und reproduktive Gesundheit“ ist eine fünfte Tarnkappe der Kultur des Todes. In zahlreichen Unterorganisationen der Vereinten Nationen wird es seit einigen Jahren propagiert. Der Begriff „sexuelle und reproduktive Gesundheit“ bzw. sexuelle und reproduktive „Selbstbestimmung“ hat auch schon Eingang in gendersensible Richtlinien für den schulischen Sexualkundeunterricht gefunden. Er umschreibt die Forderung nach einem Recht auf Abtreibung. Ein Recht auf Abtreibung kennen aber weder die Menschenrechtserklärungen der Vereinten Nationen noch die des Europarates, noch die Aktionsprogramme der Weltbevölkerungskonferenz von Kairo (1994) und der Weltfrauenkonferenz von Peking (1995). Unterorganisationen der UN, aber auch zahlreiche Staaten der westlichen Welt, üben auf Länder der Dritten Welt, die die Legalisierung der Abtreibung bisher abgelehnt haben, Druck aus, indem sie Entwicklungshilfe an die Legalisierung der Abtreibung koppeln. Die Regierung Trump hat sich von dieser Politik distanziert. Sie fördert Einrichtungen der Entwicklungshilfe nur dann mit staatlichen Mitteln, wenn diese die Entwicklungshilfe nicht von der Legalisierung der Abtreibung abhängig machen. Zur Propagierung des Rechts auf sexuelle und reproduktive Gesundheit gehören auch Bestrebungen, die Gewissensfreiheit von Ärzten, Pflegekräften und Klinikträgern, die sich weigern, an Abtreibungen mitzuwirken, einzuschränken (Elbe-Jeetzel-Klinik, Dannenberg, Februar 2017), sowie Versuche, via Anti-Fake-News-Gesetze die Meinungs- und Informationsfreiheit von Lebensrechtsorganisationen zu knebeln, die in Wort und Bild über die blutige Realität von Abtreibungen berichten und auf das Post Abortion Syndrom als Folge einer Abtreibung hinweisen.
Die deutsche Regelung der Suizidbeihilfe ist eine sechste Tarnkappe der Kultur des Todes. Der 2015 vom Bundestag verabschiedeten § 217 StGB verbietet zwar die „geschäftsmäßige“, d.h. von Sterbehilfeorganisationen wie Exit und Dignitas gegen Honorar angebotene Suizidbeihilfe, erlaubt aber ausdrücklich die private Sterbehilfe von Angehörigen oder dem Suizidenten nahestehenden Personen. Zu den nahestehenden Personen zählt auch der Hausarzt. (Winfried Hardinghaus, Deutscher Hospiz- und Palliativverband: drei akzeptabel, sieben bedenklich). Diese Regelung verknotet, wie schon die Beratungsregelung im Schwangerschaftskonflikt, das Ja und das Nein zum Lebensschutz in unentwirrbarer Weise. Dass der neue § 217 „ein starkes Zeichen für den Lebensschutz und ein Sterben in Würde“ sein soll, wie Kardinal Marx im Namen der DBK und der Ratsvorsitzende der EKD Bedford-Strohm erklärten, ist nicht nachvollziehbar. Der neue § 217 verschlechtert den Lebensschutz.
Inwieweit gehört die künstliche Befruchtung zur Kultur des Todes? Sie ist sowohl unter dem Aspekt der Weitergabe des Lebens als auch dem des Lebensschutzes ein Problem. Sie führt zu einer großen Zahl sogenannter „überzähliger“ oder „verwaister“ Embryonen, die dem Tod geweiht sind. Es werden viel mehr Embryonen erzeugt als in die Gebärmutter implantiert werden können. Auf ein nach IVF geborenes Kind kommen rund 17, die verworfen werden. Die nichtimplantierten Embryonen bzw. „Vorkernstadien“ werden eingefroren. Werden die Embryonen um der Forschung willen getötet, wird manifest, dass sie nicht als Personen geachtet, sondern als Rohstoff verwertet werden. Dies versuchte der Gesetzgeber 1990 durch das Embryonenschutzgesetz zu verhindern. Es gestattete die künstliche Befruchtung nur zum Zweck der Herbeiführung einer Schwangerschaft bei der Frau, von der die Eizellen stammen und verbot die Befruchtung von mehr als drei Eizellen. Das Gesetz wollte den Schutz des Embryos, nicht die Reproduktionsfreiheit der Eltern sicher stellen. Reproduktionsmediziner empfinden es als Fessel und würden es gern, wie schon erwähnt, durch ein Reproduktionsmedizingesetz ablösen. Aber auch dann, wenn der Frau nur die erlaubten drei Embryonen implantiert werden, wird der Lebensschutz zum Problem. Welche Frau wünscht sich Drillinge? Der offenkundigste Verstoß gegen den Lebensschutz ist der euphemistisch „Mehrlingsreduktion“ oder „fetale Reduktion“ genannte Fetozid nach erfolgreicher Implantation mehrerer Embryonen, also die Tötung eines Embryos oder mehrerer Embryonen in der Gebärmutter, wenn sich mehr als gewünscht eingenistet haben. Die Lage für die Eltern ist gewiss dramatisch. Die assistierte Reproduktion zwingt sie zu paradoxen Entscheidungen. Sie wollen ein Kind, entschließen sich aber bei der Mehrlingsreduktion zugleich, ein Kind oder mehrere töten zu lassen.
Das Embryonenschutzgesetz steht auf zerbrechlichen Füßen. Der Gesetzgeber selbst hat es inzwischen schon zweimal geschwächt – ein erstes Mal 2002 durch das Stammzellgesetz mit dem einer Tarnkappe gleichenden Titel „Gesetz zur Sicherstellung des Embryonenschutzes im Zusammenhang mit Einfuhr und Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen“, das die Einfuhr und Verwendung embryonaler Stammzellen grundsätzlich verbietet, zugleich aber zu Forschungszwecken erlaubt, wenn die Stammzellen von verwaisten oder überzähligen Embryonen stammen und vor dem 1. Mai 2007 gewonnen wurden. Von den Verheißungen der Stammzellforscher bezüglich der Therapien unheilbarer Krankheiten ist nach 20 Jahren noch keine verwirklicht worden. Ein zweites Mal wurde das Gesetz 2011 durch einen neuen § 3 a geschwächt, der wie schon das Stammzellgesetz und die reformierten §§ 218ff. StGB das Ja und das Nein zum Lebensschutz in unentwirrbarer Weise verknotet: Er verbietet die genetische Untersuchung eines Embryos in vitro, erklärt aber zugleich eine PID für „nicht rechtswidrig“, wenn auf Grund der genetischen Disposition der Eltern für den Nachwuchs das Risiko einer schwerwiegenden Erbkrankheit besteht oder wenn eine schwerwiegende Schädigung des Embryos zu erwarten ist. Das Recht auf Leben wird also abhängig gemacht vom Ergebnis einer Diagnostik. Dem ist entgegen zu halten: Das Recht auf Leben ist weder von der Qualität noch von der zu erwartenden Dauer des Lebens abhängig. Es steht auch dem kranken und dem behinderten Embryo zu und dem, dessen Lebenserwartung nur wenige Tage oder Stunden beträgt.
I. Die Zukunft Europas
Wie soll Europa der Kultur des Todes entgehen? Unter welchen Bedingungen lässt sich der Kultur des Todes eine Kultur des Lebens gegenüberstellen? Was kennzeichnet eine Kultur des Lebens? Einen Hinweis gab bereits die Salzburger Erklärung. Sie lenkte den Blick auf die Ökologie des Menschen und unterstrich: „Zur Ökologie des Menschen gehört … eine neue Wertschätzung von Vaterschaft und Mutterschaft und ihrer Bedeutung für die Gesellschaft“ (Z.26). Zur Ökologie des Menschen gehört eine neue Wertschätzung der Familie als einer auf Dauer angelegten Gemeinschaft verschiedener Geschlechter und Generationen.
1. Die Bedeutung der Familie
Jedes Land hat ein vitales Interesse, so der 5. Familienbericht der Bundesregierung (1994), „diejenigen privaten Lebensformen besonders auszuzeichnen, zu schützen und zu fördern, welche Leistungen erbringen, die nicht nur für die Beteiligten, sondern auch für die übrigen Gesellschaftsbereiche notwendig sind.“ Die Lebensform, von der hier die Rede ist, ist die Ehe und die aus ihr hervorgehende Familie. Seit Jahrhunderten werden Ehe und Familie in sehr verschiedenen politischen Systemen, in verschiedenen Kulturen und Religionen moralisch wie rechtlich geschützt, gefördert und privilegiert, weil sie nicht nur den Wünschen der beteiligten Personen entsprechen, sondern der ganzen Gesellschaft Vorteile bringen. Ehe und Familie sorgen zum einen für die physische Regeneration der Gesellschaft, mithin für ihre Zukunft, und zum anderen für die Bildung des Humanvermögens der nächsten Generation. Ehe und Familie sorgen in der Regel für die Geburt von Kindern, nicht weil die Eltern an die Zukunft der Gesellschaft denken, sondern weil sie sich lieben. Die Zeugung eines Kindes ist die Inkarnation ihrer Liebe. Homosexualität ist demgegenüber „eine zur Fortpflanzung und Eröffnung einer Zukunft des Menschen grundsätzlich unfähige Gestalt von Sexualität“, so die Salzburger Erklärung (Z. 28). Homosexuelle Partnerschaften können deshalb nicht mit der Ehe gleichgestellt werden. Sie sind generationenblind und lebensfeindlich. Wer die „Ehe für alle“ ablehnt, macht sich deshalb weder der Homophobie noch der Diskriminierung schuldig.
Das Humanvermögen, das primär in der Familie erworben wird, ist die Gesamtheit der Daseins- und Sozialkompetenzen des Menschen, die dem Erwerb von beruflichen Fachkompetenzen vorausliegen. Diese Daseins- und Sozialkompetenzen sind für die Entwicklung der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Kultur von kaum zu überschätzender Bedeutung. In der Familie werden die Weichen gestellt für die moralischen und emotionalen Orientierungen des Heranwachsenden, für seine Lern- und Leistungsbereitschaft, für seine Kommunikations- und Bindungsfähigkeit, seine Zuverlässigkeit und Arbeitsmotivation, seine Konflikt- und Kompromissfähigkeit und seine Bereitschaft zur Gründung einer eigenen Familie, zur Weitergabe des Lebens und zur Übernahme von Verantwortung für andere. In der Familie wird über den Erfolg im schulischen und beruflichen Erziehungs- und Ausbildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt und in der Bewältigung des Lebens vorentschieden. In der Familie lernt das Kind, was lieben und geliebt werden heißt, was es konkret besagt, Person zu sein.
Die Bedeutung der Familie als Ressource für das Gemeinwohl wird noch einmal deutlich, wenn die Folgen untersucht werden, die das Zerbrechen von Familien und die Relativierung der Ehe verursachen. Diese Folgen betreffen zunächst die Eheleute selbst, dann die Kinder, schließlich die Gesellschaft und den Staat und nicht zuletzt generationenübergreifend die demographische Entwicklung. Sie gleichen einer pathologischen Spirale. Das Scheitern einer Familie vermindert Gesundheit, Wohlstand und Wohlbefinden – die drei Dinge, an denen die Menschen in der Regel am meisten interessiert sind. Verminderte Gesundheit, verminderter Wohlstand und vermindertes Wohlbefinden belasten die Beziehungen und verstärken und perpetuieren so den Teufelskreis des Scheiterns.
2. Die Bedeutung kultureller und institutioneller Rahmenbedingungen
Zu einer Kultur des Lebens gehören aber neben der neuen Wertschätzung der Familie weitere kulturelle und institutionelle Rahmenbedingungen, die die Identität Europas geprägt haben. „Die europäische Identität ist keine leicht erfassbare Wirklichkeit“, sagte Papst Johannes Paul II. in einer Ansprache im Europarat 1988 in Straßburg. „Die weit zurückliegenden Quellgründe dieser Zivilisation sind vielfältig. Sie stammen aus Griechenland und aus Rom, aus keltischem, germanischem und slawischem Boden, aus dem Christentum, das sie tief geprägt hat. Und wir wissen, welche Verschiedenheiten an Sprachen, Kulturen, Rechtstraditionen die Nationen, die Regionen und auch die Institutionen kennzeichnen! Aber im Hinblick auf die anderen Kontinente erscheint Europa wie eine einzige Einheit, auch wenn der innere Zusammenhang von denen, die zu Europa gehören, weniger klar erfasst wird. Dieser Blick kann Europa helfen, sich selbst besser wiederzufinden. In fast zwanzig Jahrhunderten hat das Christentum dazu beigetragen, eine Sicht der Welt und des Menschen zu entwickeln, die heute ein grundlegender Beitrag bleibt – jenseits der Zerrissenheit, der Schwächen, ja sogar der Versäumnisse der Christen selbst.“ In dieser Sicht der Welt, des Menschen und der Gesellschaft will ich einige Dimensionen unterstreichen, die Europas spezifische Identität ausmachen.
a) Die Unterscheidung zwischen geistlichen Angelegenheiten und weltlichen Dingen oder zwischen Religion und Politik steht am Anfang der modernen europäischen Identität. Im antiken Griechenland und im Imperium Romanum waren Religion und Politik noch eine Einheit. Diese Einheit führte viele der ersten Christen ins Martyrium, weil sie sich weigerten, den römischen Kaiser als einen Gott zu verehren. Aus den Konflikten der ersten Christen mit den politisch-religiösen Autoritäten entwickelte sich die bis heute gültige und den freiheitlichen Verfassungsstaat tragende Unterscheidung zwischen Spiritualia und Temporalia, zwischen Religion und Politik. Nicht nur die res publica, die Welt schlechthin wird entgöttlicht. Die Politik wird relativiert, die Herrschaftsgewalt des Königs beschränkt.
b) Der christliche Glaube schärft den Blick für den Wert des einzelnen Menschen, um dessentwillen Christus selbst Menschennatur angenommen hat. Der Mensch ist Person. Er hat eine unantastbare und unveräußerliche Würde, die – so auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Abtreibungsstrafrecht 1993, „schon dem ungeborenen menschlichen Leben zukommt“. Der Mensch ist Gottes Ebenbild, d.h. nicht nur von Gott geschaffen, sondern sich nach ihm sehnend, auf ihn hin lebend und in ihm seine Vollendung findend. „Das biblische Menschenbild hat es“ – so Johannes Paul II. vor dem Europarat 1988 – „den Europäern gestattet, eine große Vorstellung von der Würde des Menschen als Person zu entwickeln, die einen wesentlichen Wert auch für diejenigen bedeutet, die keinen religiösen Glauben haben“.
c) Ein wichtiges Merkmal europäischer Identität ist die positive Einstellung zur Welt. Sie ist die Grundlage der Erforschung der Natur in der Wissenschaft, die Grundlage auch der Technik und der Industrie, des Handels und einer globalen Politik. Diese neugierige Hinwendung zur Welt begann gewiß schon in der griechischen Antike. Aristoteles ist ebenso ihr Repräsentant wie Alexander der Große. Aber sie erhielt mit dem Christentum eine neue Qualität. Nicht nur der Auftrag des Buches Genesis an den Menschen, sich die Welt, die Gott geschaffen und als gut bezeichnet hatte, untertan zu machen, verpflichtete ihn auf diese Welt, sondern viel mehr noch die Inkarnation selbst. Wenn Gott sich nicht zu schade war, selbst Mensch zu werden und in diese Welt zu kommen, dann kann auch der Christ kein Feld seines alltäglichen Lebens von seiner Verpflichtung zur Nachfolge Christi, seinem Auftrag, sich selbst und die Welt zu heiligen, aussparen. Der Christ lebt seinen Glauben nicht nur im Tempel, im Gottesdienst oder beim Opfer, sondern im alltäglichen Leben in Familie und Beruf. Er hat seine tägliche Arbeit in Gebet zu verwandeln und die Welt zu lieben – nicht jene Welt der Hoffart, des Stolzes, der Begierde und der Prahlerei, vor der Johannes warnt (1 Joh 2,15), sondern die Welt, die zu retten Jesus Mensch wurde und aus der seine Jünger nicht herauszunehmen er seinen Vater bittet (Joh 17,15). Jesu Menschwerdung in Betlehem impliziert den Weltauftrag für jeden Christen. Nicht die Verachtung der Welt, sondern die Heiligung der Welt ist der Auftrag der Christen. Die Flucht aus dem Alltag, der Rückzug in fromme oder bequeme Nischen ist ihm verwehrt.
d) Die Menschenrechte sind gewiss eine späte Entwicklung in der europäischen Kultur. Erst am Ende des 18. Jahrhunderts werden sie erstmals formuliert. Da sie während der Französischen Revolution und in den laizistischen Traditionen des 19. Jahrhunderts in Europa oft als Waffe gegen die Kirche benutzt wurden, gestaltete sich das Verhältnis der Kirche zu den Menschenrechten über eineinhalb Jahrhunderte hinweg als schwierig und konfliktreich. Die menschliche Freiheit wurde als Befreiung von Gott missverstanden. Diese Spannung löste sich erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Dennoch wage ich mit Josef Isensee zu sagen: Das Christentum hat den Menschenrechten den Boden bereitet. „Christliches Erbe in den Menschenrechten sind die Leitgedanken von der Einheit des Menschengeschlechtes und von der Gleichheit seiner Glieder, von der Einmaligkeit und Würde eines jeden Menschen als Person, unverfügbar den anderen und sich selbst, berufen zu Eigenverantwortung, zu Nächstenliebe und zur Bewährung in dieser Welt. Nur im christlichen Kulturkreis … konnten die Menschenrechte sich entwickeln“. Der Mensch hat diese Rechte, weil er Mensch ist, also von Natur aus. Der Staat ist zwar für ihre Durchsetzung von Bedeutung, aber er schafft sie nicht. Sie haben eine naturrechtliche Wurzel. In geradezu klassischer Weise bringt dies das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Artikel 1 zum Ausdruck: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht“.
e) Zur Identität Europas gehört der freiheitliche Verfassungsstaat, dessen Zweck die Herrschaft des Rechts, die Gewährleistung der Menschenrechte und damit die Sicherung der Freiheit der Bürger ist. Der freiheitliche Verfassungsstaat ermöglicht die Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung. Er ist das Fundament der Demokratie. Er verlangt die Teilung der politischen Gewalten. Er hat seine Wurzeln in der athenischen Polis, in den Nomoi Platons und der „Politik“ sowie der „Nikomachischen Ethik“ des Aristoteles, aber auch in der römischen Res publica und in Ciceros „De officiis“. Im freiheitlichen Verfassungsstaat zeigt sich aber auch das Erbe des Christentums. Die gleichberechtigte Teilnahme aller Bürger am politischen Willensbildungsprozess, die die athenische Polis und die römische Res publica nicht kannten, ist eine logische Konsequenz des christlichen Menschenbildes. Es betonte die Gleichheit der Würde aller Menschen und führte, wenn auch nach langen Kämpfen, zur Abschaffung der Sklaverei. Zu diesem Menschenbild gehört auch die Ambivalenz der menschlichen Natur. Der Mensch kann gut oder böse, konstruktiv oder destruktiv handeln. Er kann die politische Macht zur Förderung des Gemeinwohls, aber auch zu seiner Zerstörung gebrauchen. Daraus zieht der freiheitliche Verfassungsstaat die Konsequenz, die politische Macht auf die Legislative, die Exekutive und die Judikative zu verteilen, um so eine Balance und eine gegenseitige Kontrolle zu erreichen. Gewaltenteilung heißt Machtbegrenzung. Ein erster Schritt zur Machtbegrenzung war bereits die Unterscheidung zwischen Spiritualia und Temporalia. Aber die Gewaltenteilung geht darüber hinaus. Sie bändigt mit der Trennung und gegenseitigen Kontrolle legislativer, exekutiver und judikativer Macht die Temporalia selbst. Sie will die Versuchung zum Machtmissbrauch minimieren und da, wo Macht dennoch missbraucht wird, die schädlichen Folgen begrenzen.
f) Dass der Staat nicht nur Rechtsstaat, sondern auch Sozialstaat sein muss, auch das gehört zu dem, was Europas Identität ausmacht. Der soziale Rechtsstaat sorgt nicht nur für Recht und Sicherheit, sondern auch für menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen. Er schützt die Bürger gegen Einkommensrisiken, die aus Krankheit, Invalidität, Alter und Arbeitslosigkeit erwachsen. Er gewährleistet mit der sozialen Sicherheit soziale Gerechtigkeit, gesellschaftliche Integration und individuelle Freiheit. Diese Aufgabe des Gemeinwesens ist ein christliches Erbe. Schon im Mittelalter galt die Sorge für die Armen, die Witwen und die Waisen als Aufgabe des christlichen Gemeinwesens, derer sich die Klöster, die Orden, die Spitäler und Hospize annahmen. Sie setzt die Fähigkeit zum Mitleiden mit dem in Not geratenen Mitmenschen voraus. Dazu gehört auch das Asylrecht. Wer auf Grund seiner Volks- oder Stammeszugehörigkeit, seiner Rasse, seines Geschlechts oder seiner Religion verfolgt wird, hat das Recht auf Asyl, solange die Verfolgung anhält. Wer vor einem Krieg flieht, hat das Recht auf Schutz, solange der Krieg dauert, und die Pflicht zur Rückkehr, wenn der Krieg beendet ist. Diese Pflicht ist nicht abhängig vom Grad der Zerstörung bzw. des Wiederaufbaus des Herkunftslandes oder vom Grad der Integration in das Fluchtland. Armut, wirtschaftliche Not oder die Auswirkungen von Krisen und Kriegen reichen ebenso wenig für die erfolgreiche Berufung auf das Asylrecht aus wie die Flucht vor politischer Instabilität. Ein sozialer Rechtsstaat hat die Pflicht, zwischen Verfolgten, Kriegsflüchtlingen und Migranten zu differenzieren. Diese Differenzierung ist die Voraussetzung, um bei der Bewältigung der Flucht von mehreren Millionen Menschen aus den Kriegsgebieten des Nahen und Fernen Ostens und aus Afrika sowohl der Not der Flüchtlinge als auch dem Recht und der Pflicht jedes Staates auf Kontrolle seiner Grenzen, mithin dem Gemeinwohl des Einwanderungslandes gerecht zu werden. Zu dieser Pflicht gehört auch die Prüfung der Bereitschaft und der Fähigkeit der Migranten zur Integration.
g) Eine letzte Dimension europäischer Identität ist die internationale Kooperation. Wie kein anderer Kontinent hat Europa im 20. Jahrhundert internationale Kooperations- und Integrationsstrukturen entwickelt. Skeptiker mögen dem entgegenhalten, dass auch von keinem anderen Kontinent derartige nationalistische Abgrenzungen und Kriege ausgingen wie von Europa. Dies gehört in der Tat zu den Schattenseiten dessen, was Europa ausmacht. Aber zu dem, was Europa ausmacht, gehört auch das kontinuierliche und erfolgreiche Bemühen um Versöhnung, um Kooperation, um völkerrechtliche Strukturen und um Integration. „Wenn man ‚Europa‘ sagt, soll das ‚Öffnung‘ heißen“, schrieb Johannes Paul II. in Ecclesia in Europa (2003) Europa habe sich dadurch aufgebaut, dass es über die Meere hinweg auf andere Völker, andere Kulturen, andere Zivilisationen zugegangen ist.
Dieses Europa zu erhalten ist eine Herausforderung für die Christen, auch wenn ihr Glaube vielerorts schwach geworden ist. Es ist ihre Aufgabe, die eigenen Wurzeln neu zu entdecken und eine Zivilisation zu entwickeln, die zugleich christlicher und menschlich reicher ist. Das Kreuz ist das Logo dieser Zivilisation. „Die Erneuerung Europas muss ihren Ausgangspunkt nehmen vom Dialog mit dem Evangelium“, erklärte die Sonder-Synode der Bischöfe für Europa 1991 nach dem Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs. Für die Neuevangelisierung Europas „genügt es deshalb nicht, sich um die Verbreitung der ‚Werte des Evangeliums‘ wie Gerechtigkeit und Frieden zu bemühen. Wir kommen nur dann zu einer wirklich christlichen Evangelisierung, wenn die Person Jesu Christi verkündet wird.“ Dass dies nicht einfach ist, hat schon der Apostel Paulus auf dem Areopag in Athen und auch in Korinth erfahren. Dass es dennoch gelingen kann, zeigt die Geschichte Europas, zeigen die Heiligen und die Begegnungen Johannes Pauls II. und Benedikts XVI. mit Jugendlichen aus aller Welt bei den Weltjugendtreffen, aus denen viele Berufungen hervorgingen, ebenso die Europäischen Jugendtreffen der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé. „Habt keine Angst! Öffnet, ja reißt die Tore weit auf für Christus!“ Mit diesem Wort begann Johannes Paul II. am 22. Oktober 1978 sein Pontifikat, in dem die Spaltung Europas überwunden wurde. Habt keine Angst! Dieses Wort gilt auch uns im 21. Jahrhundert. Mit einem langen Gesicht und mit Wehleidigkeit hätten die ersten Christen die Welt nicht verändert. Hinter ihrer Botschaft stand die froh machende Erfahrung, Jesus, dem Erlöser, nahe zu sein. Wo Jesus in die Nähe kommt, schreibt Josef Ratzinger, „da entsteht Freude. Lukas, der Evangelist,…hat diesen Faden nicht aus dem Auge verloren. Der letzte Satz des Evangeliums sagt uns nämlich: Als die Jünger den Herrn hatten auffahren sehen, da gingen sie weg, das Herz voll Freude (Lk 24,25)… Rein menschlich würden wir erwarten, voll Verwirrung. Nein, wer den Herrn nicht nur von außen gesehen hat, wer sich sein Herz von ihm berühren ließ, wer den Gekreuzigten angenommen hat und, eben weil er den Gekreuzigten angenommen hat, die Gnade der Auferstehung kennt, der muss voller Freude sein“ (Diener eurer Freude, 1988, S.48f.). „Macht euch keine Sorgen; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke“ (Buch Nehemia 8, 10).
Prof. Dr. Manfred Spieker (Osnabrück)
Vortrag beim VIII. Ökumenischen Bekenntniskongress der Internationalen Konferenz bekennender Gemeinschaften „Quo vadis Europa? Europa als Herausforderung für die Christen“ am 5. Oktober 2019 in Hofgeismar
Aus: Diakrisis, 40. Jahrgang, Dezember 2019
Quelle: Gemeindenetzwerk




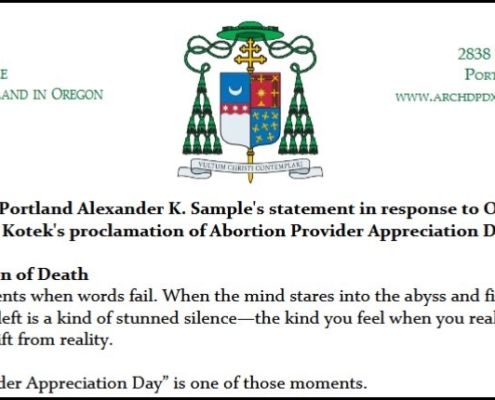






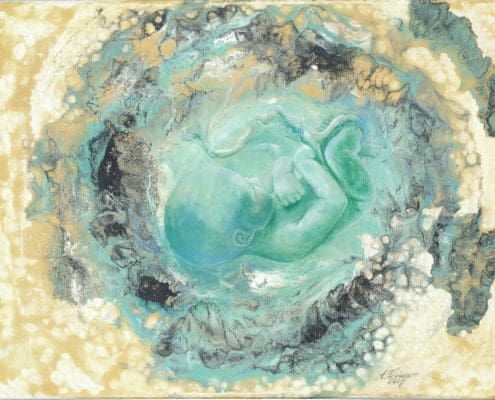 © Susanne Georgi
© Susanne Georgi
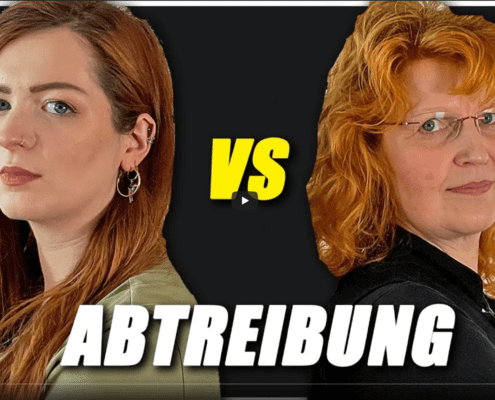






 Andreas Schroth
Andreas Schroth
